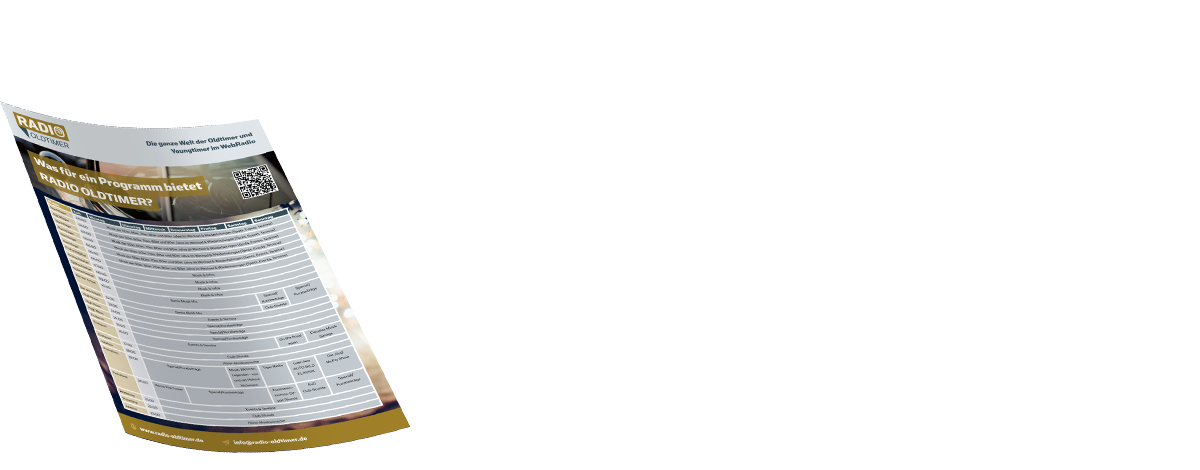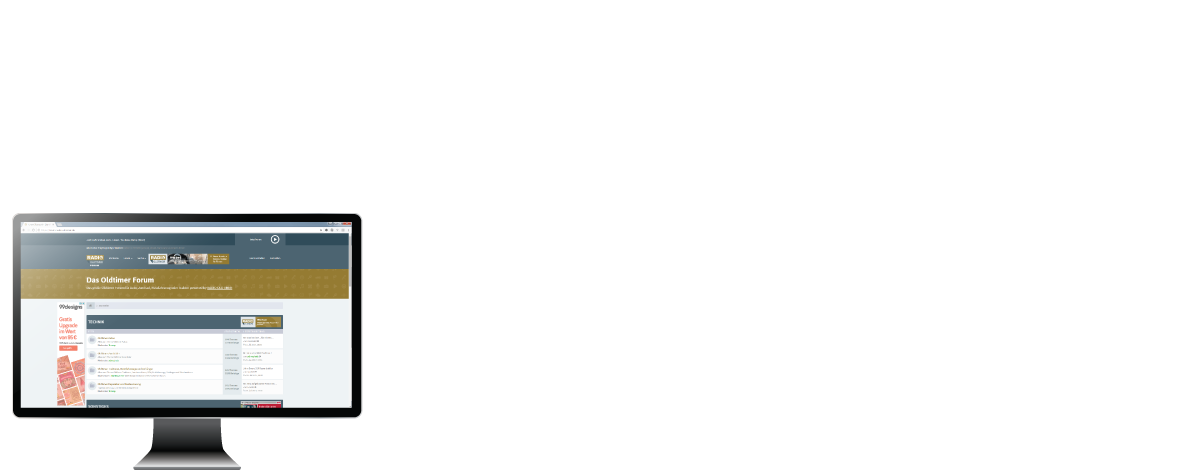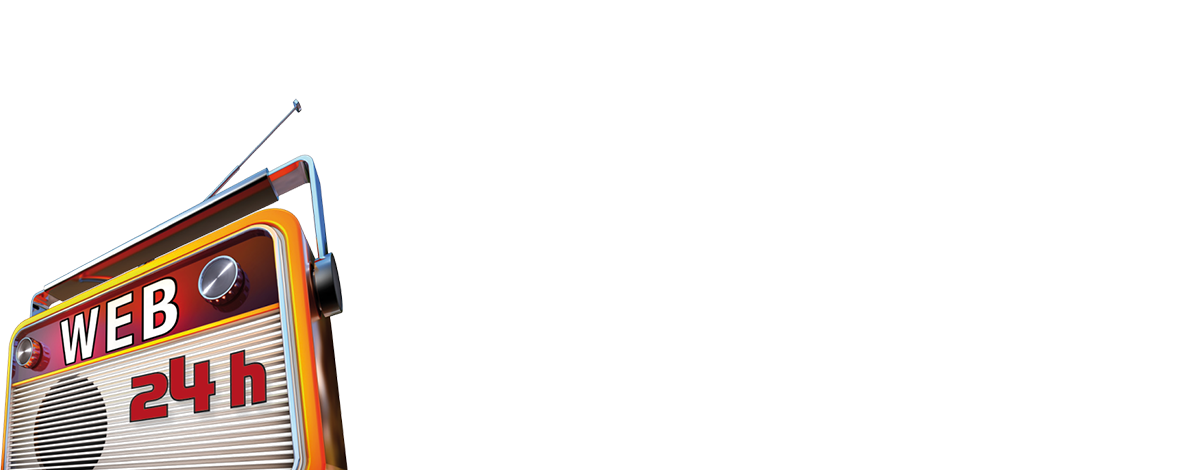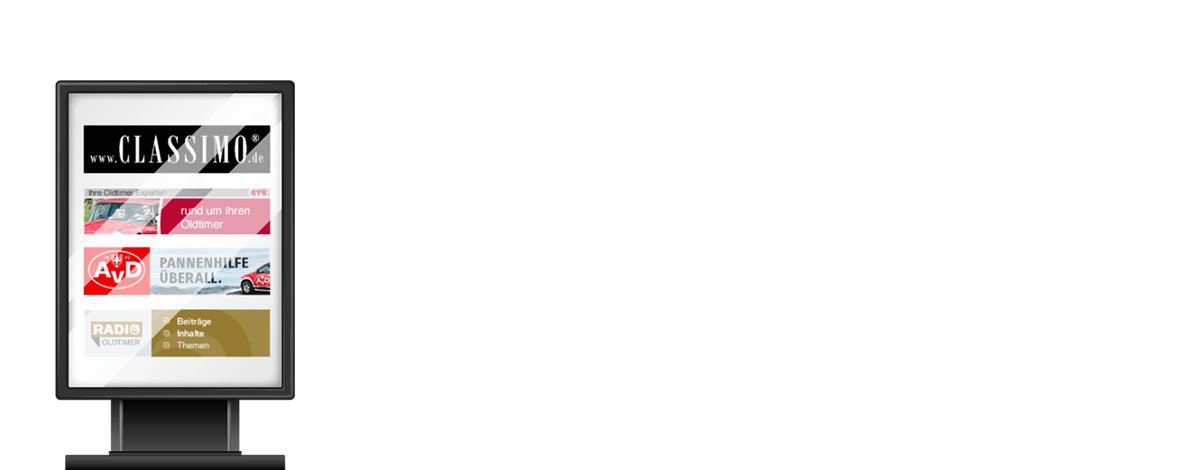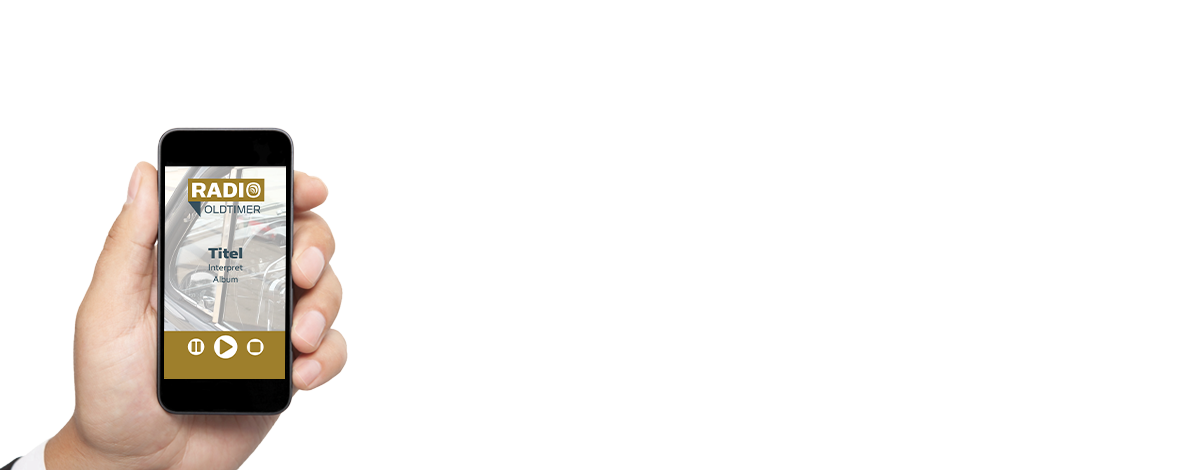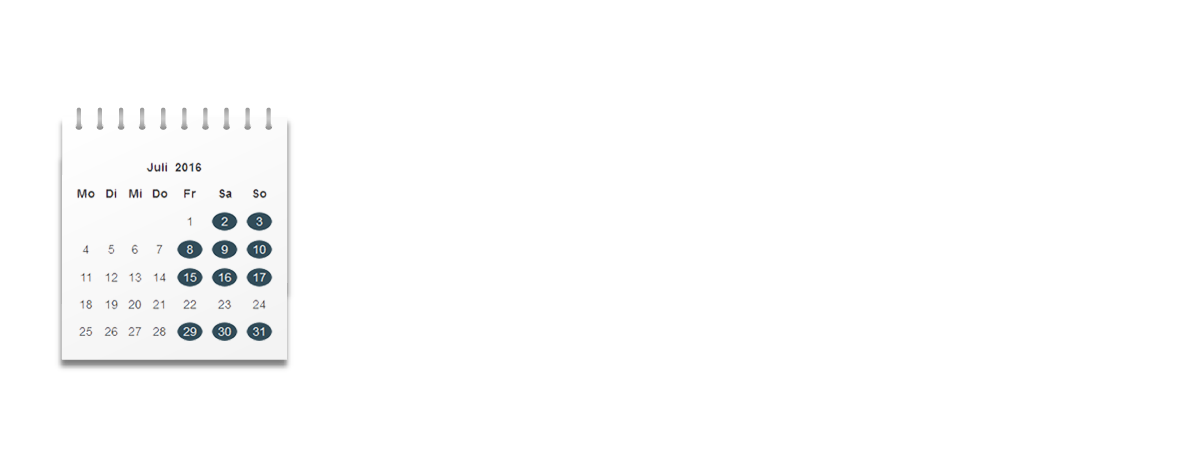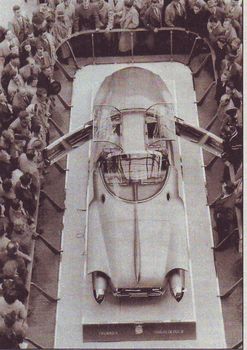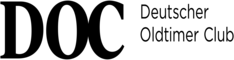Großes war mit Kleinen geplant. Der Nano (Zwerg) sollte der Volkswagen Indiens werden. Und am besten natürlich auch ein Dauerbrenner wie der berühmte VW Käfer. Doch dem gut drei Meter kurzen Winzmobil des Herstellers Tata war nur ein sehr kurzes Dasein und nur eine verschwindend niedrige Stückzahl beschieden. Angepriesen für umgerechnet etwa 2000 Euro sollte es Millionen Inder ab Juli 2009 runter vom Motorrad und rein in dieses Auto locken. Möglich wurde der Preis, weil die Lohnkosten im Tata-Werk extrem niedrig waren und es weder irgendeine Sicherheitsausstattung noch Komfortdinge wie Servolenkung oder gar eine Klimaanlage zu bestellen gab.
Doch entgegen der Erwartung, wesentlich gespeist von den optimistischen Voraussagen vermeintlich allwissender Marktforscher, spielte die Kundschaft nicht mit. So kam es, dass der Nano keine zehn Jahre nach der Markteinführung im Sommer 2018 Kurs auf den Autofriedhof nehmen musste. Die Hauptgründe dafür hätten die Marketingstrategien des Konzerns vorher wissen können: Dass nämlich solch ein schmalbrüstiges Autochen (mit 28 oder 38 PS) gerade in der indischen Gesellschaft als Armutsbeweis angesehen wird.Die Massen knatterten lieber weiter auf Mopeds oder Kleinmotorrädern durch die Lande, was zur Folge hatte, dass sich die Nano-Produktion stetig nach unten entwickelte. Bis zum Absturz 2017. Damals schwankte sie zwischen 100 bis 1000 Exemplaren pro Monat, was einer Tagesherstellung von zeitweise nur noch zwei Fahrzeugen entsprach. Tiefpunkt war schließlich der Oktober 2017 mit nur noch 57 Stück. Kurz darauf wurden die Blechpressen gestoppt.Ähnliches widerfuhr auch Tatas Vorbild Volkswagen – allerdings nicht mit einem Billigheimer, sondern Ende 2001 wollte der damalige VW-Chef Ferdinand Piëch den Luxuslimousinen-Markt aus den Angeln heben. Besitzern des relativ biederen VW-Modells Passat sollte endlich ein Prestige-Aufstieg innerhalb der Wolfsburger Marke ermöglicht werden. Man hätte sich lediglich den VW Phaeton als neues Rangabzeichen der gesellschaftlichen Oberschicht zuzulegen brauchen – und schon, so die Annahme der Strategen, wäre man mithilfe dieses edlen VW-Blechs plötzlich wer. Mögliche Umsteiger auf die Spitzenmodelle von Mercedes, BMW oder auch der VW-Tochter Audi sollten mit dem Erwerb eines Phaeton zur Markentreue animiert werden.Und um der anvisierten Zielgruppe des Automobils das Gefühl zu geben, nicht nur einen schnöden fahrbaren Untersatz zu erwerben, sondern ein ganz exquisites Beförderungsmittel, sollte der an sich simple Zusammenbau zudem als feinste Handwerkstätigkeit zelebriert werden, der von außen beigewohnt werden kann: In der eigens für diese Luxus-Kalesche errichteten gläsernen Manufaktur in Dresden.Entsprechend pompös war das Tamtam, als der Start der Serienproduktion dieses fahrenden Salons am 11. Dezember 2001 in Sachsens Hauptstadt gefeiert wurde. Bundeskanzler Gerhard Schröder war eigens angereist. Selbstverständlich war auch Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf anwesend. Und natürlich Ferdinand Piëch, der auf einem Stuhl in der ersten Reihe der proppenvollen Eingangshalle des gläsernen Betriebes saß. Denn auf dessen Order hin wurde nicht nur das Auto entwickelt, sondern eben auch jene Show-Fabrik für rund 187 Millionen Euro errichtet, in der damals die Party stieg.Vor mehreren hundert Gästen spielte die Staatskapelle Dresden. Ferner gab es verschiedene Gesangsdarbietungen. Anschließend trat Gerhard Schröder an das Rednerpult. Er setzte kleine verbale Seitenhiebe indem er sagte: „Ich war damals im Aufsichtsrat des Unternehmens, als die Idee (zu dem Auto) entwickelt worden ist und schließlich beschlossen wurde. Ich habe zu denen gehört, die von der Konzeption überzeugt worden sind, und das hat sich auch nicht geändert. Wer die Überzeugungskraft von Dr. Piëch – jedenfalls auf diesem Gebiet – kennt, der weiß, wie so etwas geht. Für ihn ist Teamwork eben, wenn alle das tun, was er will. Das betrifft auch den Aufsichtsrat.“ Daraufhin war leichte Erheiterung im Publikum zu vernehmen. Nur einer starrte ohne erkennbare Mimik auf den Laudator Schröder: Ferdinand Piëch. Wer sich gut 17 Jahre später die Nase an den großen Fensterflächen der gläsernen Manufaktur platt drückt, um zu erleben, wie solch ein Luxusschlitten von Hand sorgsam zusammengebaut wird, sieht nur einen vergleichsweise biederen Golf – denn seit März 2016 ist die Produktion des Phaeton eingestellt. Stattdessen wird in dem einstigen Renommierwerk mit Show-Charakter nun die Elektroversion des Golf zusammengebaut. Dabei sollte der Phaeton, benannt nach einem Sohn des griechischen Sonnengotts Helios, schnurstracks Kurs auf den Olymp der Autogötter nehmen. Ein Automobil für die oberen Zehntausend. Eines, dass es mit Image trächtigem Zwölfzylindermotor genau so gab wie später mit einem Sechszylinder-Diesel. Doch der Wagen wurde zur Standuhr, wie schwer verkäufliche Autos in der Branche genannt werden. Die Absatzerwartung von 20 000 Stück pro Jahr hat der Fünf-Meter-Lulatsch nie erfüllt. Laut Geschäftsbericht wurden 2011 die meisten Phaeton hergestellt: 11 166 Stück. Danach kam der Absturz: 2014 lag die Produktion nur noch bei rund 4000 Autos. Spätestens in der Zeit wurde den Verantwortlichen klar, dass mit dem Phaeton kein Staat zu machen war. So hochwertig das Auto gewesen ist, die Erkenntnis war bitter, dass der auch auf Prestige achtende typische Firmenboss halt keinen Volkswagen fährt – bis auf die Volkswagenvorstände selbstverständlich. Analysten schätzten bereits Anfang 2015, dass VW pro Wagen 28 000 Euro zubuttern musste. Zuletzt kostete der Luxusschlitten mindestens 89 650 Euro – ohne Sonderausstattung. Nur rund 84 000 Phaeton wurden in 15 Jahren Bauzeit hergestellt. Unterm Strich ein gigantischer Flop, der den Konzern mehr als zwei Milliarden Euro gekostet haben dürfte.Nur ein kleines Marktsegment zu erobern wie VW wäre General Motors (GM) mehr als 50 Jahre vor dem Phaeton viel zu wenig gewesen. Die Manager hatten weit Größeres im Sinn, als 1958 im Waldorf Astoria Hotel in New York mordsmäßig auf dicke Hose gemacht wurde. Es sollte nicht weniger als der gesamte Autobau revolutioniert werden. Ein Hauch von Hollywood umwehte die Szenerie. Gleißende Scheinwerfer, sphärische Klänge und eine Tanzcombo bildeten den Rahmen für die Präsentation des Firebird III, einer Art Raumschiff auf Rädern. Es wirkte so, als würde es sogleich zur nächsten Galaxie starten. Chefdesigner Harley Earl, als Zwei-Meter-Hüne selbst eine Schau und zudem in Hollywood geboren, sagte bei der Präsentation: „Das ist das Auto, mit dem Sie eines Tages zum Astroport fahren werden, wenn Sie ihren Trip zum Mond antreten.“ Eines mit drei riesigen Leitwerken hinten, vier weiteren Stummelflügeln drum herum sowie zwei neben einander angeordneten Plexiglaskuppeln für je einen Reisenden. Unter der imposanten Hülle steckte eine 225-PS-Gasturbine, anstelle eines Lenkrads gab es einen Steuerknüppel, mit dem Gas gegeben und gebremst werden konnte.Dass der markige Satz des Chefdesigners nicht über den Stellenwert eines Horoskops hinaus gekommen ist, verwundert nicht weiter. War doch die Straßenrakete nichts weiter als eine spinnerte Studie oder ein verrücktes Gedankenspiel mit dem Ziel, die Medien zu füttern. Und viel zu weit weg von den Bedürfnissen der Autofahrernation USA. Viel später blieb allerdings ein Rest dieser Vision übrig: 1967 fand der Name Eingang in das Modell-Universum von GM – als Pontiac Firebird.In der Geschichte des Autos gab es Unmengen solcher verheißungsvollen Ankündigungen wie auch die absonderlichsten Kuriositäten. Zum Beispiel den elektrisch betriebene Nucleon, den Ford ebenfalls 1958 im damals anbrechenden Atomzeitalter vorstellte – allerdings nur als Modell. Der geplante Mini-Kernreaktor unter der Haube sollte für etwa 8000 Kilometer den Antriebsstrom liefern. Was er indes nur lieferte, waren die beabsichtigten Schlagzeilen. Selbst technikhörige Fans mochten schon damals nicht recht glauben, dass das geplante Atomauto jemals eine Chance auf Realisierung haben könnte. Rasch verschwand diese Idee in der Grabbelkiste der Verrücktheiten.Abseits solcher Verirrungen fanden allerdings auch ernst gemeinte Serienmodelle den Weg in die Sackgasse der Unsterblichkeit als technisch oder wirtschaftliches Missverständnis. Etwa der Peugeot 1007 im Jahr 2005. Das war ein Minivan mit zwei speziellen und von den Entwicklungskosten her sündhaft teuren Schiebetüren, deren geringer Platzbedarf beim Öffnen insbesondere in engen Innenstädten segensreich sein sollte. Das war sicher der Fall.Doch der angepeilten Kundschaft fehlte der Chic und obendrein war das Wägelchen mit einem Durchschnittspreis von etwa 14 000 Euro sogar teurer als ein kleineres Modell der Marke. Peugeot wollte vom Typ 1007 jedes Jahr 120 000 Stück verkaufen. Doch soviel wurden es gerade in der gesamten fünfjährigen Bauzeit von Anfang 2005 bis Ende 2009. Der Versuch Peugeots, dieses Auto zu etablieren, kostete angeblich 1,9 Milliarden Euro.Eines der berühmtesten Missverständnisse ist die Schlagzeilen trächtige Affäre um den Ford Edsel, der im August 1957 auf den Markt kam und schon bald einen Ehrenplatz auf dem Pannenstreifen der Erinnerung eingenommen hat. Die Limousine, für 250 Millionen Dollar entwickelt, schaukelte nur etwas mehr als zwei Jahre über die Highways. Bis zum Produktionsende 1959 fand der Ford lediglich knapp 102 000 Kunden. Das entsprach damals weniger als einem Prozent aller Autoverkäufe in den USA. Kalkuliert hatte Ford jedoch mit mindestens 200 000 Stück – pro Jahr.Die miesen Zahlen lagen auch an der katastrophalen Qualität. So verfielen manche Edsel bei Kälte in eine merkwürdige Starre. Ursache waren die bei Minustemperaturen verhärteten Schaltseile im Automatikgetriebe. Und die wasserbettmäßige Straßenlage war selbst den Amerikanern zu viel, die an Wabbelfahrwerke gewöhnt waren.Der wesentliche Grund jedoch, weswegen der Edsel zum Ladenhüter und zu einem Streitobjekt wurde, ist ein anderer. Der mit bis zu 350 PS starkem Motor lieferbare Muskelmann brannte auf dem Scheiterhaufen der öffentlichen Moral, weil sein senkrecht stehender Kühlergrill so manche Frau an eine Vagina erinnerte. Angestachelt von Hausfrauenverbänden protestierten viele Damen vor Ford-Händlern gegen dieses Auto. Damit war sehr schnell die Luft aus den Reifen. Am 19. November 1959 beendete Ford das Leben des Edsel – mit mehr als einer Milliarde Dollar Verlust.Etwa zur gleichen Zeit machte Carl F. W. Borgward auf der anderen Seite des Atlantiks in Bremen von sich reden. Er schenkte den Aufsteigern der Nachkriegszeit die famose Isabella – damit aber auch inkontinente Automatikgetriebe sowie Einspritzmotoren mit Dampfblasenbildung ab Werk, was zum Stottern des Motors führte. Auch Borgwards anderes Modell, die kokette Arabella mit Heckflossen, war qualitätsmäßig leider unter aller Kanone. Im Volksmund wurde der Wagen „Bananenauto“ genannt, weil es ab der Auslieferung durch Nachbesserungen erst beim Kunden reifte. Zu Anfang zerbröselten die Getriebe schneller als die Besitzer das Regenwasser aus dem Fußraum schöpfen konnten. Die Undichtigkeiten führten zum Spottnamen „Aquabella“. 1961 kam der Konkurs.Ob es 1967 die erste Keilform-Limousine NSU Ro 80 war, deren revolutionärer Wankelmotor zunächst mit seinem turbinenartigen Lauf faszinierte, der aber andererseits wegen hartnäckigen Ölverlusts öfter verreckte, oder ob es die VW-Typen 1500 und 1600 TL ab 1961 waren, deren Besitzer die Macken entweder mit Selbstironie verarbeiten oder den Spott anderer ertragen mussten. Während sich zum Beispiel entgegenkommende Ro 80-Fahrer am Steuer mit Handzeichen begrüßten, die Zahl der Finger stand für die Anzahl der Tauschmotoren, hatten TL-Besitzer die Häme hinzunehmen, eine „Traurige Lösung“ zu fahren. Das eigentlich als Aufstiegsmodell vom Käfer gedachte Auto mit Schwabbelfahrwerk und schlappem Motor zog keinen Hering vom Teller. 1969 kam schließlich das Aus für beide Schrägheck-VW, 1977 das für den mutigen Wankel-Versuch.Nicht besser erging es Volkswagen bei einem anderen Versuch, ein Mittelklassemodell zu etablieren. Es geht um den K 70, der von 1970 bis 1975 vom Band lief. Heute wissen wir, dass aus dem K 70 etwas hätte werden können. Frontmotor, Wasserkühlung, Frontantrieb, viel Platz – er konnte alles früher als die anderen Volkswagen. Und das war gleichzeitig sein Problem. Der K(olbenmotor) 70, ein vom übernommenen Hersteller NSU ungeliebtes Stiefkind, war bereits so modern, dass er Volkswagen überforderte, Konstrukteure wie Käufer. Der Wagen hatte es schwer, bei der klassischen VW-Klientel, die Heckmotor-Fahrzeuge und das typische Design schätzte, Anklang zu finden. Zudem kratzten Qualitätsmängel am Lack, die Modellpflege verlief schleppend und halbherzig. Im Mai 1975 schließlich war der Fall K 70 für VW nach nur 211 000 hergestellten Stück beendet. Auch, weil er trotz modernster Technik sein enormes Spießer-Image niemals losgeworden ist.All diese Fälle waren Millionen- oder Milliardengräber. Aber gegen das Debakel, das sich die Verantwortlichen der GM-Marke Chevrolet mit dem Modell Corvair Mitte der 60er-Jahre eingebrockt hatten, waren sie nichts. Vor allem vom Image-Crash her. Der damals noch unbekannte amerikanische Verbraucheranwalt Ralph Nader hatte in seinem Buch „Unsafe at any speed“ (Unsicher bei jeder Geschwindigkeit) katastrophale Schwächen des Corvair aufgedeckt. Obwohl Ingenieure bei der Entwicklung darauf hingewiesen haben, dass das Heckmotorkonzept zusammen mit der Billig-Hinterachse eine starke Neigung zum Ausbrechen besitzt, bestanden die Kostendrücker auf dieser Lösung. Effekt: Es kam zu tausenden schweren Unfällen. GM keilte auf sehr eigene Weise auf Mister Naders Enthüllungen zurück. Der Autoriese ließ den Anwalt beim Einkaufen von Blondinen belagern. Zweck: Die zumeist knackigen Damen sollten den Mann in der damals sexuell noch sehr verklemmten US-Gesellschaft moralisch unmöglich machen. Zu dumm, dass die Absicht der Nummer öffentlich wurde. So bekam nicht nur das Image von Chevrolet tiefe Beulen, die Firma musste auch viele Millionen Dollar Schadensersatz an die Kunden zahlen. 1969 wurde die Corvair-Produktion eingestellt.Kreative Köpfe schraubten zu allen Zeiten am Automobil solange rum, bis es den eigenen Touch hatte. Immer in der Hoffnung, daraus eine Serie und viel Geld machen zu können. Zum Beispiel die Idee, dem Automobil das Fliegen beizubringen. Der Amerikaner Moulton „Molt“ Taylor war so jemand. Er stellte 1949 und 1950 drei Versionen seines Aerocar vor. Geschäftlich und auch sonst bescherten ihm diese Kreuzungen jedoch nur harte Landungen. Taylor wie auch andere Erfinder, die am fliegenden Auto rumdokterten, unterschätzten nämlich, dass ihre Geschöpfe immer Kompromisse waren. Entweder flogen sie schlecht (mit zumeist darauf folgenden Abstürzen) oder sie fuhren saumäßig. Mithin also keine Chance auf massenhafte Verbreitung.Der Berliner Hans Trippel bevorzugte 1960 das Wasser als Medium. Sein Amphicar, ausgestattet mit zwei kleinen Kunststoffpropellern unter dem Heck, tuckerte auf vier Rädern in die Fluten eines Sees oder eines Flusses und wurde dort zum Schiffchen. Das Amphibienauto besaß durchaus ulkigen Charme. Und wenn es aus dem Wasser an den flachen Strand schwamm und wieder festen Boden unter die Räder bekam, amüsiertem sich Passanten angesichts der ungewöhnlichen Szene. Heute noch sorgt die Kreuzung aus Auto und Boot für Erstaunen, sobald sich bei Amphicar-Treffen die Meute ins feuchte Element aufmacht. Doch Erfolg war auch Hans Trippel mit dem 38-PS-Fahrzeug nicht vergönnt. Nach nur drei Jahren Bauzeit und knapp 3900 hergestellten Stück wurde 1963 der Stöpsel gezogen.1964 war es wieder der Autoriese GM, der sich aus heutiger Sicht Unerhörtes traute und ein Auto für eine spezielle Zielgruppe zeigte: Der Runabout, der auf der Weltausstellung in New York als kommendes Hausfrauenauto angepriesen wurde. Das Auto hatte drei Räder. Wobei das Vordere zum besseren Einparken um 180 Grad gedreht werden konnte. Hinten hatten die Konstrukteure einen ausfahrbaren Einkaufswagen installiert. Der Sinn dahinter: Die Hausfrau zieht am Supermarkt den leeren Einkaufswagen aus dem Heck raus und schiebt ihn später voll wieder rein. Zuhause kann sie den Einkauf dann bis zum Kühlschrank rollen. Auch wenn sich damals offenbar niemand über den Macho-Gedanken hinter dem Auto aufregte, vom Konzept her trug es bereits die Gene eines Flops in sich und kam nie über den Status eines Einzelstücks hinaus.Richtige Gurken, in denen niemand gerne gesehen werden möchte und die tatsächlich in Produktion gingen, gibt es auch in der Neuzeit. Etwa der erste Fiat Multipla, der 1998 gleich als Designunfall geboren wurde. Motto: Darin möchte man nicht tot überm Lenkrad hängen. In spöttischen Kommentaren der Leserschaft von Autoblättern wurde unter anderem gemutmaßt, dass die außerordentliche Hässlichkeit des Wagens womöglich einen Vorteil besitzen könnte: ein unfreiwilliger Diebstahlschutz. Nach heftiger Stilkritik von allen Seiten an der Warze auf Rädern meinte Fiat vermeintlich selbstbewusst: „Da müssen wir auf dem Weg zum Kultauto durch.“ Wenig später jedoch wurde das Design des Wagens aufgehübscht. Im Jahr 2000 veranstalteten die Moderatoren der US-Radiosendung „Car Talk“ unter ihren Hörern die Wahl des schlechtesten Autos des Jahrhunderts. Abgestimmt wurde übers Internet. An erster Stelle stand der Yugo des jugoslawischen Herstellers Zastava. Der Kommentar eines der Wähler: „Immerhin hatte er eine beheizbare Heckscheibe. So blieben die Hände beim Anschieben wenigstens warm.“ Der zweite Platz ging an den Chevrolet Vega, der, so meinte einer, „aus komprimiertem Rost gebaut worden ist“. Auf Rang drei folgte der Ford Pinto, zu dem sich so geäußert wurde: „In unserer Straße wurden eines Nachts zwölf Autos gestohlen, nur der Pinto meines Vaters stand am nächsten Morgen noch da.“ Hübsch ist auch der Kommentar zum Plymouth Volare, der Siebter geworden ist: „Die Lenkung war so mies, dass ich mir einen Weg zur Arbeit suchen musste, auf dem ich nur Rechtskurven zu fahren brauchte.“ Den bislang dreistesten Versuch, mit einem reinen Marketingmanöver der Kundschaft ein Auto aufzuschwatzen, leistete sich 2011 Aston Martin. Unter der Bezeichnung „Cygnet“ (kleiner Schwan) wollte das neuerdings an der Londoner Börse als eigenständige Aktiengesellschaft geführte Auto-Unternehmen eine Art Einkaufswagen für die Upper Class durchsetzen. Dabei war der nur 2,99 Meter lange Luxuszwerg nichts weiter als ein optisch aufgemotzter Toyota iQ. Die Strategie dahinter: Man lasse sich ein kleines Großserienauto an das Aston-Martin-Werk im englischen Gaydon liefern, staffiere es innen mit Komplettleder und sonstigen Spielereien aus, spendiere ihm den typischen Kühler der noblen Sportwagenmarke, klebe vorne und hinten die Aston-Martin-Logos drauf, lasse aber die Motorleistung bei zahmen 98 PS und treibe dafür aber den Preis kräftig in die Höhe. Um genau zu sein: von damals 15 950 Euro für den billigsten Toyota iQ rauf auf 37 995 Euro für den billigsten, aber elitär wirkenden kleinen Schwan. Und schon erhält man ein Luxusschlittchen für die Stadt. Die Spitzenversion stand sogar mit 50 445 Euro in der Preisliste. Doch der Plan des damaligen deutschen Aston Martin-Chefs Ulrich Bez ging krachend in die Hose. 4000 Stück sollten von dem Dritt- oder Viertwagen abgesetzt werden. Doch nur 593 Stück fanden Platz in den ohnehin bereits überfüllten Garagen des Geldadels. Sodass dem Schwänlein bereits 2013 die Flügel gestutzt werden mussten.